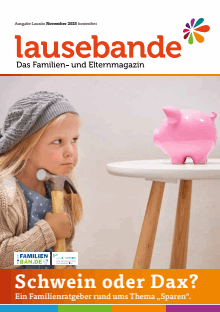Die Heinz Sielmann Stiftung zählt zu den maßgeblichen NGOs Deutschlands, die sich mit Schutzgebieten für Natur und Artenvielfalt einsetzen. Für die fachliche Planung und Betreuung dieser Gebiete ist mit Dr. Heiko Schumacher ein Experte für Biodiversität zuständig – wir sprachen mit ihm über Erfolge und Herausforderungen im Naturschutz:
Die Heinz Sielmann Stiftung feierte im letzten Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Was hat die Stiftung seit 1994 erreicht?
Ein wesentlicher Aspekt ist die Flächensicherung für den Natur- und Artenschutz. Gerade in Brandenburg konnten wir im Bereich von Bergbaufolge und Truppenübungsplätzen große zusammenhängende Flächen erwerben – bundesweit haben wir derzeit rund 13.000 Hektar in Eigentum und Verwaltung. Wir gehören im Bereich der Schutzgebiete damit zu den zentralen Akteuren wie Nabu, BUND oder die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Das sind oft Flächen – gerade bei Truppenübungsplätzen – die natürlich anspruchsvoll, aber naturschutzfachlich auch extrem wertvoll sind. Wir betreiben auf unseren Flächen ein regelmäßiges Monitoring und sehen genau, wie die Artenvielfalt dort von Jahr zu Jahr zunimmt. In Wanninchen in der Lausitz haben wir so aktuell rund 1.600 Arten festgestellt, in der Döberitzer Heide sind es inzwischen sogar über 6.700. Die Liste der kleinen und großen Erfolge ist lang. Wir haben dabei nicht nur viele einzelne Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt sichern, entwickeln und wissenschaftlich begleiten können, sondern die Natur in unseren Erlebnis- und Besucherzentren auch unzähligen Menschen nähergebracht – mit hoffentlich bleibender Wirkung!
Die Stiftung verfolgt aktiv Großprojekte in ganz Deutschland mit einem besonderen Schwerpunkt in Ostdeutschland. Was macht den Osten so attraktiv für Renaturierungsvorhaben?
Nach der politischen Wende wurden große, oft unzerschnittene Landschaften „frei“ – ob nun ehemalige Militärflächen oder auch die Bereiche früherer Tagebaue. Diese Flächen waren einerseits für die biologische Vielfalt besonders wertvoll und andererseits auch für konventionelle Nutzungen oft uninteressant. In dieser Kombination haben sich Verbände oder auch Stiftungen wie wir gefunden, diese Flächen dem Erhalt und der Entwicklung der Biodiversität sowie der Umweltbildung zu widmen.
In Sachen Renaturierung scheint die Wiederherstellung von Wäldern besonders gängig. Warum setzt die Heinz Sielmann Stiftung stattdessen mit ihren Heide- und Seen- sowie Auenlandschaften vorrangig auf die Erhaltung offener Lebensräume?
Dieser Schwerpunkt hat auch etwas mit der Verfügbarkeit von Flächen zu tun. Sowohl Truppenübungsplätze als auch Heide- und Bergbaufolgelandschaften konnten nach der politischen Wende vergleichsweise günstig erworben werden – und sie bieten sich aufgrund fehlender Zerschneidung und ausgebliebener Belastung etwa durch Pestizide für artenreiche Offenlandstrukturen an. Hier leben auch Brachpieper und Heidelerche, heute sehr seltene Vogelarten. Sie benötigen wie viele andere Arten auch offene oder halboffene Lebensräume, die nicht zuwachsen. Gerade in Südbrandenburg hat sich auf Gebieten mit ehemaliger Militärnutzung eine solche Heidelandschaft ausgeprägt. In der Döberitzer Heide haben wir durch die Einbringung großer Pflanzenfresser wie Wisent und Przewalski-Pferd ein national beispielhaftes Großprojekt für eine beweidete Offenlandschaft umgesetzt. Durch den Fraß und Tritt von Wisent und Pferden entstehen offene Stellen, die ideale Nistplätze für bedrohte Wildbienen bieten. Der Dung der Großtiere bietet Lebensraum für viele Insekten wie Mistkäfer, Pillendreher & Co., die wiederum vielen Vogelarten Nahrung bieten. Hier hat sich in verschiedenen Lebensräumen – von feuchteren Senken und lichten Baumbeständen bis zu kargen Höhen – eine enorme Vielfalt ausgeprägt. Aber wir engagieren uns auch in Waldbereichen, wie dem Görlsdorfer Wald in der Naturlandschaft Wanninchen, in dem Hirschkäfer und Mittelspecht beheimatet sind. Es kommt letztendlich auf das Miteinander und die Vielfalt der Lebensräume an. Vielfältige Lebensräume ziehen eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzen nach sich. Wir sollten also sowohl Wälder, als auch halboffene oder offene Landschaften wie Heiden, Trockenrasen oder Seen und Flussauen erhalten und pflegen. Das ist auch unser Stiftungsmotto: Vielfalt ist unsere Natur!
Wo sollte Natur- und Artenschutz Ihrer Meinung nach ansetzen – zuerst auf regionaler Ebene oder sollten Schutzmaßnahmen gleich global angegangen werden?
Beides hängt untrennbar miteinander zusammen! Daher wird auch vom Großen – wie bei dem weltweiten Übereinkommen über die biologische Vielfalt – bis zum „Kleinen“ – wie zum Brandenburgischen Maßnahmenprogramm zur biologischen Vielfalt – heruntergebrochen. Für die Menschen vor Ort ist die Sichtbarkeit der Maßnahmen und ihres Erfolgs besonders wichtig. Sie wollen sehen, dass die Natur vor ihrer Haustür mit den typischen Tier- und Pflanzenarten erhalten bleibt – ob das nun seltene Arten, wie den Wiedehopf, oder früher häufige, wie Star oder Feldlerche, betrifft.
Wenn wir über bedrohte Arten reden, sind die gängigen Beispiele fast immer Säugetiere wie Panda, Nashorn und Co. – ist dieser Fokus auf Säugetiere gerechtfertigt?
In unserer Naturlandschaft Wanninchen machen wir in Anspielung auf die bekannten „Big Five“ in Afrika ganz bewusst Werbung für die „Small Five“. Wer kennt schon sandbewohnende Insekten wie den Sandohrwurm oder den Wiener Sandlaufkäfer? Das ist aber eher für die interessierte Öffentlichkeit. Die breite Öffentlichkeit erreichen auch wir schlichtweg leichter mit Arten, die Fell und Federn haben. Diese „Sympathieträger“ liegen den meisten Menschen einfach eher am Herzen als z. B. kleine, unscheinbare Käferarten. Mit dem Schutz der Lebensräume dieser „attraktiven“ Schirmarten, wie in unserem Fall des Wisents, können wir allerdings sehr viel für den Erhalt der zahlreichen, nicht so prominenten Arten tun. Insofern ist es richtig, die Bedeutung der Biodiversität über solche Arten zu transportieren – wenngleich die Bedrohung leider die meisten Artengruppen, ob groß oder klein, attraktiv oder unscheinbar, betrifft.
Wir werden durch die Medien immer wieder mit dem kritischen Zustand unserer Natur und dem massiven Rückgang der Artenvielfalt konfrontiert. Wie erklären Sie sich, dass wir trotz allgemeiner Kenntnis der Problematik des Artensterbens Lösungen immer auf die lange Bahn schieben?
Oft reagieren wir als Menschen eben erst, wenn die Probleme uns unmittelbar betreffen. Leider sind es seit Jahren immer wieder andere Themen, die unserer Gesellschaft als wichtiger erscheinen. Krankheiten in der Corona-Pandemie, dann Inflation, aktuell Kriege waren und sind überlagernde Themen, die Menschen direkt erfassen und stärker berühren können. Auch Klimaschutz ist eingängiger. Wenn 2038 der letzte Gletscher in Deutschland verschwindet, Temperaturen steigen oder in Brandenburg vermehrt Wälder brennen, wirkt das einfach unmittelbar. Biodiversität und das Netz des Lebens sind da deutlich schwerer zu vermitteln. Es braucht oft lange, bis wir merken, dass uns wichtige Funktionen der biologischen Vielfalt verloren gehen – angefangen bei der Lebensqualität, wenn die Lerche nicht mehr über dem Feld singt, bis hin zu ganz praktischen Aspekten wie der Herstellung von Medikamenten. Wenn Arten nach und nach verschwinden, werden Auswirkungen nicht sofort spürbar, aber auf lange Sicht wird das Netz des Lebens immer brüchiger und verliert irgendwann den Zusammenhalt. Leider schadet die schleichende und langfristige Entwicklung der Aufmerksamkeit im Moment – trotz Zunahme der Dringlichkeit beim Artenschwund. Wir haben es mit einer Aufmerksamkeitstreppe zu tun, in der aktuelle Ereignisse meist oben stehen und das Engagement der Menschen binden. Letztendlich entscheidet Klimaschutz darüber, wie wir künftig leben. Aber Biodiversität entscheidet darüber, ob wir als Menschen überhaupt überleben können.
Gerade künftige Generationen werden die Konsequenzen der aktuellen Umweltzerstörung und des Artensterbens schultern müssen – eine frühzeitige Begeisterung für den Natur- und Artenschutz ist für sie demnach besonders wichtig. Wird dies aus Ihrer Sicht in der Kita- und Schulbildung ausreichend berücksichtigt?
Wir sehen, dass das Thema zunehmende Bedeutung auch in der Bildungsarbeit von Kindern und Jugendlichen einnimmt. Andererseits sind Kita- und Schulbildung von einer Zunahme an Themen und einem Mangel an Personal geprägt. Wir sehen das aktuell mit der Diskussion um Konzentration auf die sogenannten Basiskompetenzen. Wir gehen deshalb direkt in die Schulen und laden Kita- und Schulgruppen zu uns sein. In Wanninchen betreiben wir dazu seit vielen Jahren ein Erlebniszentrum mit vielen Veranstaltungen, in der Döberitzer Heide haben wir im vergangenen Jahr ein modernes Natur- und Erlebniszentrum eröffnet. Wir engagieren uns also zunehmend für Umweltbildung, würden uns aber natürlich wünschen, dass Natur- und Artenschutz auch stärker im Bildungskanon von Kita und Schule verankert werden. Für die jungen Generationen wird das absehbar zu den großen Herausforderungen der Zukunft zählen.
Welche Tipps haben Sie für Familien, die sich aktiv am Natur- und Artenschutz beteiligen wollen?
Da mir Biodiversität am Herzen liegt, würde ich zuerst in den eigenen Garten schauen. Man muss im Herbst dort nicht alles kurz und klein schneiden. An vielen Stängeln haben Insekten Eier abgelegt oder überwintern als Larven. Wo es Nachbarn nicht stört, kann man einen Bereich verwildern lassen, sodass sich Kleintiere darin verkriechen oder Vögel brüten können. Für genauso wichtig halte ich es, mit Kindern in die Natur zu gehen und diese gemeinsam zu erkunden. So wird früh Interesse für Natur und Arten geweckt – und wer das vertiefen möchte, ist natürlich gern in unseren Naturerlebniszentren etwa in Wanninchen bei Luckau und der Döberitzer Heide gesehen. Wir bieten dort breit gefächerte Erlebnisangebote insbesondere für Kinder und Familien an.
Kommt der Natur- und Artenschutz mit rein staatlichen Mitteln aus oder ist er auf die Beteiligung von uns (kleinen und großen) Bürgern angewiesen – und wenn ja, wie können Familien am sinnvollsten unterstützen?
In Deutschland haben NGOs wie wir viele wichtige Aufgaben im Natur- und Artenschutz übernommen. Das ist in anderen Ländern ähnlich. In autoritären Staaten sind NGOs wiederum kaum gelitten, hier betrachten wir aktuelle globale Entwicklungen mit Blick auf Biodiversität als weltweite Herausforderung durchaus mit Sorge. Unsere Arbeit wird dadurch umso wichtiger – und da wir uns gemeinnützig engagieren, sind wir wie unsere Mitstreiter auch auf Spenden angewiesen. Das ist bei uns ganz gezielt für bestimmte Projekte oder Vorhaben möglich und kommt ausschließlich der wichtigen Arbeit für Natur- und Artenschutz zugute. Hier können Familien zielgenau und mit einem Wunschbetrag nach ihren Möglichkeiten unterstützen. Auch Testamentsspenden spielen eine immer wichtigere Rolle für uns. Wer seine Kinder und Liebsten versorgt weiß und mit einem Teil seines Erbes etwas Gutes bewirken möchte, sollte ernsthaft erwägen, Naturschutzorganisationen wie die Heinz Sielmann Stiftung im Testament zu bedenken.
In ganz Europa – so auch bei uns in Deutschland – herrscht eine angespannte politische Lage: bei Migration, Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft kommen Umwelt- und Artenschutz eher unter die Räder – sehen Sie in den kommenden Jahren eher schlechte Zeiten auf den Natur- und Artenschutz zukommen oder glauben Sie an eine zunehmende Relevanz?
Wir müssen nicht drumherum, reden: Die Zeiten werden im Moment schwieriger, auch wenn die Relevanz zunimmt. Wenn Sie mich privat fragen, ist es manchmal durchaus zum Verzweifeln, das immer irgendetwas anderes wichtiger ist und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft fesselt. Es passiert aber auch etwas – so sind in unserem Land aktuell hohe Milliardenbeträge für Klima- und Umweltschutz vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass der natürliche Klimaschutz hier auch mitberücksichtigt wird. In Bezug zur Arbeit bleibt meine Motivation auch mit dieser Zuversicht ungebrochen. Wir sehen ja die dramatische Entwicklung im Artenschwund, die sich in Teilen weiter beschleunigt. Die Bedeutung unserer Arbeit wird ganz sicher weiter zunehmen. Unsere Schutzgebiete beweisen inzwischen, dass unser Weg eine sinnvolle Investition in die Lebensqualität künftiger Generationen ist und nachhaltige Lösungen für das Netz des Lebens liefert – mit vielen kleinen und manchmal fast täglichen Erfolgen beim Arten- und Naturschutz. Genau diese Wirksamkeit lässt mich positiv in die Zukunft blicken – und sie liefert trotz aller Wirrnisse ein hohes Maß an Lebensglück.
Über die Heinz Sielmann Stiftung
Seit mehr als 30 Jahren setzt sich die Heinz Sielmann Stiftung erfolgreich für den Naturschutz ein – mit einem besonders starken Engagement in Brandenburg und der Lausitz. Dazu erwirbt und pflegt die Stiftung große, unzerschnittene Landschaften, um seltene Lebensräume für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten. Außerdem gestaltet sie Biotopverbünde – das sind Netze aus Lebensräumen und Verbindungselementen – in denen sich Arten wie auf Trittsteinen bewegen und sich ausbreiten können und so für gesunde und stabile Populationen sorgen. In unserer Nähe betreut die Stiftung gleich drei große Naturschutzprojekte: die Döberitzer Heide als große Offenlandschaft mit Weidetieren wie Wisent, Hirsch und Przewalski-Pferd, die Groß Schauener Seen samt Seeadler und Flussseeschwalbe und die Naturlandschaft Wanninchen bei Luckau, wo sich Wolf und Kranich gute Nacht sagen – und die in diesem Jahr 25 Jahre Jubiläum feiert.
Spenden für mehr Biodiversität und die wertvollen Projekte der Stiftung können ganz gezielt für bestimmte Projekte, Flächenkäufe oder beispielsweise den Schutz der Wisente als Einmalspende oder monatliche Spende vorgenommen werden. Der untenstehende Link führt direkt zur Online-Spende. Alternativ kann natürlich auf das Spendenkonto der Stiftung eingezahlt werden:
Spendenkonto Sparkasse Duderstadt
IBAN: DE62 2605 1260 0000 0003 23
BIC: NOLA DE 21 DUD
https://www.sielmann-stiftung.de/helfen/aktuelle-spendenprojekte