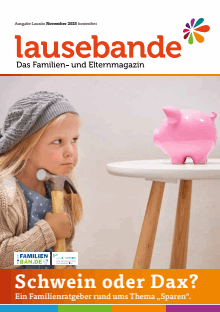Wie Genossenschaften die Welt ein wenig besser machen
Das Rührei zum Frühstück, der Wochenend-Einkauf im Supermarkt, die Taxifahrt zum Bahnhof, das Konto bei der Bank des Vertrauens, die große Familienwohnung oder der nachhaltige Solarstrom aus der Nachbarschaft. Fast überall im Alltag haben wir mit Genossenschaften zu tun – manchmal ganz bewusst als Mitglied und manchmal indirekt, wenn wir Produkte oder Dienstleistungen von Genossenschaftsmitgliedern nutzen.
Die etwa 200 Jahre alte Genossenschaftsidee ist dabei aktueller denn je. Die Vereinten Nationen (UN) haben 2025 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen und lenken damit zugleich den Fokus auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Denn die genossenschaftlichen Prinzipien Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung sind wie geschaffen für die Erreichung eben dieser Ziele, zu denen unter anderem der Kampf gegen Armut, der Ausbau hochwertiger Bildung und nachhaltiges Produzieren und Konsumieren gehören. „Genossenschaften sind die Lösung für viele globale Herausforderungen unserer Zeit“, so UN-Generalsekretär António Guterres.
Doch warum sollen ausgerechnet Genossenschaften dabei helfen, Hunger und Krieg, Armut und Ungleichheit zu bekämpfen? Weil sie wie keine andere Rechtsform für Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, demokratische Kultur, Sicherheit und Stabilität stehen. Dagegen stehen bei anderen Rechtsformen wie der GmbH oder der Aktiengesellschaft oft Rendite, Profit und Gewinnmaximierung im Vordergrund.
„Genossenschaften fördern regionales Unternehmertum, ermöglichen den Zugang zu Märkten und bekämpfen weltweit Armut und soziale Ausgrenzung. Genossenschaften
gestalten eine bessere Welt.“
António Guterres, UN-Generalsekretär
Die Grundprinzipien der Genossenschaft
Das Genossenschaftsmodell beruht auf drei Grundprinzipien: Förder-, Demokratie- und Identitätsprinzip. Wichtigstes Ziel einer Genossenschaft ist nicht der wirtschaftliche Gewinn, sondern die Förderung der eigenen Mitglieder (Förderprinzip). Weil die Eigentümer bzw. Mitglieder zugleich die Nutzer sind, haben sie Interesse an einer nachhaltigen Geschäftsführung (Identitätsprinzip). Genossenschaften sind demokratisch organisiert, denn jedes Mitglied verfügt unabhängig vom eingebrachten Kapital über eine Stimme (Demokratieprinzip). Am Beispiel einer Wohnungsgenossenschaft bedeutet das: Die Mitglieder sind gleichzeitig Mieter und Vermieter (Identitätsprinzip). Ihr Ziel ist die Versorgung mit preisgünstigem, sicheren Wohnraum (Förderprinzip). In der General- oder Vertreterversammlung, in der u. a. die Verwendung und Ausschüttung von Überschüssen beschlossen wird, können alle gewählten Mitgliedsvertreter unabhängig von der Höhe ihrer Genossenschaftseinlage mit einer Stimme abstimmen (Demokratieprinzip).
Eine Gewinnerzielungsabsicht ist per se kein genossenschaftlicher Förderzweck. Es geht nicht um kurzfristige Kapitalinteressen, sondern um eine nachhaltige Förderung der Mitglieder. Nichtsdestotrotz können und sollen auch Genossenschaften Gewinne erzielen, diese kommen aber der Genossenschaft und damit den Mitgliedern zugute, indem beispielsweise in Neuanschaffungen investiert wird. Zudem spenden viele Genossenschaften einen Teil ihrer Gewinne für soziale Zwecke. Genossenschaften stehen für ein solides Geschäftsmodell und langfristiges unternehmerisches Handeln. Nachhaltigkeit gehört zu ihrer DNA. Weltweit vertrauen eine Milliarde Menschen dieser DNA – als Mitglied einer Genossenschaft.
Durch ihre besondere Struktur und den Genossenschaftsgedanken sind Genossenschaften wie eine große Familie, in der man aufeinander achtgibt und gemeinsam an einem großen Ziel arbeitet: „Die Genossenschaftsfamilie verstand sich von jeher als eine an sozialen Werten orientierte Bewegung, die auf ideellen Grundsätzen wie Solidarität, Ehrlichkeit, Verantwortung, Demokratie aufbauend eine alternative Wirtschaftsform bildet.“ Das sagte die damalige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Claudia Bogedan, 2016. Damals wurde die Genossenschaftsidee und -praxis in die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen – als erster deutscher Beitrag auf dieser internationalen Liste.
Genossenschaften weltweit: Genossenschaften sind auf allen Kontinenten verbreitet. Insgesamt gibt es etwa drei Millionen, davon 855.000 in Indien und 250.000 in Europa. Jede zweite Bank in Europa ist eine Genossenschaftsbank, in Finnland sind 75 Prozent der Bevölkerung Mitglied einer Genossenschaft, in Polen wohnt jeder Dritte in einer Genossenschaftswohnung. In Italien gibt es in Europa die meisten landwirtschaftlichen Genossenschaften: gut 4.700 Betriebe. In Brasilien ist die Genossenschaftsidee im Gesundheitswesen weit verbreitet. Die meisten Ärzte dort sind in einer der 720 Gesundheitsgenossenschaften organisiert. In Japan werden 54 Prozent der gesamten inländischen Produktion aus Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei von Genossenschaften verarbeitet und vermarktet. In der argentinischen Stadt Sunchales wurden an allen Grund- und weiterführenden Schulen Schülergenossenschaften etabliert. Sie betreiben beispielsweise ein Schulradio, stellen Keramik her oder haben eine Bäckerei gegründet.
Die Geschichte der Genossenschaften
Das passt auch deswegen, weil die historischen Ursprünge dieser Idee unter anderem in Deutschland zu finden sind. „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ Dieser Satz geht auf Friedrich Wilhelm Raiffeisen zurück. Er gilt neben Hermann Schulze aus dem sächsischen Delitzsch als Begründer der Genossenschaften in Deutschland. Sie griffen damit beide eine Idee aus dem industriellen England auf, wo Anfang des 19. Jahrhunderts in Textilfabriken dieses Prinzip unter den Arbeitern umgesetzt wurde. Gut zwei Dutzend Weber taten sich zusammen, um als Konsumgenossenschaft Materialien günstiger einkaufen und weitergeben zu können.
Kurz darauf folgten die ersten Genossenschaftsgründungen in Deutschland. Auch sie stellten die Idee von Selbsthilfe und Solidarität in den Mittelpunkt. Im Laufe der Zeit breiteten sich Genossenschaften in Deutschland weiter aus und etablierten sich in verschiedenen Wirtschaftszweigen, darunter im Bankwesen, in der Landwirtschaft und im Wohnungswesen. Das sind auch jene Branchen, in denen sie heute am weitesten verbreitet sind. Genossenschaften stehen für faire Finanzberatung, nachhaltige Landwirtschaft, umweltfreundliche Energieversorgung, für bezahlbaren Wohnraum.
In Deutschland vertrauen etwa 22 Millionen Menschen als Genossenschaftsmitglied dieser Idee von Solidarität, Mitbestimmung und Demokratie. Nicht zuletzt sind Genossenschaften ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor: Die etwa 7.000 deutschen genossenschaftlichen Unternehmen sind Arbeitgeber für eine Million Beschäftigte und erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 1,5 Billionen Euro, wobei allein die Genossenschaftsbanken mit einer Bilanzsumme von 1,2 Billionen Euro und knapp 18 Millionen Mitgliedern den Löwenanteil ausmachen.
„In einer Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umbrüche hat Friedrich Wilhelm Raiffeisen für seine Mitmenschen Verantwortung übernommen und gezeigt, was das Engagement des Einzelnen und die Solidarität vieler gerade in schwierigen Zeiten bewirken können. Das macht für mich seine Idee und sein Wirken so modern.“
Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident
Genossenschaftliche Branchen im Überblick
Bankwesen: Genossenschaftsbanken stehen für Vertrauen und für ein solides Geschäftsmodell. Deutschlandweit vertrauen ihnen 18 Millionen Mitglieder und 30 Millionen Kunden. Als Finanzierungspartner des Mittelstands leisten sie einen wichtigen Beitrag für die regionale Wirtschaft.
Die genaue Kenntnis des regionalen Marktes und der persönliche Kontakt zu den Menschen vor Ort ist ihr großer Wettbewerbsvorteil. Durch die flächendeckende Bereitstellung von Finanzdienstleistungen fördern sie Wirtschaftswachstum und stabile Arbeitsplätze auch abseits der Großstädte. Am bekanntesten sind die Volksbanken und Raiffeisenbanken, daneben gibt es die genossenschaftlich organisierten Sparda-Banken, die PSD Banken, Kirchenbanken und weitere.
Zahlen Dtl. 2024: 697 Banken, 135.000 Beschäftigte, 1,2 Bio. € Bilanzsumme, 17,8 Mio. Mitglieder
Landwirtschaft: Landwirtschaftliche Genossenschaften, auch Raiffeisengenossenschaften genannt, spielen weltweit eine wichtige Rolle in der Nahrungsversorgung und Vermeidung von Hunger. Sie verbinden lokale Produzenten im ländlichen Raum mit internationalen Märkten, verbessern die Ernährungssicherheit und stärken insbesondere kleinere landwirtschaftliche Betriebe. Die Hälfte aller Warenströme von und zur Landwirtschaft in Deutschland wird über genossenschaftliche Unternehmen abgewickelt. Mit fast 110.000 Beschäftigten sind sie zudem wichtige Arbeitgeber im ländlichen Raum. Besonders verbreitet sind sie – historisch bedingt – in Ostdeutschland. Hier werden 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch Agrargenossenschaften bewirtschaftet.
Zahlen Dtl. 2024: 1.656 Unternehmen, 110.000 Beschäftigte, 82,6 Mrd. € Umsatz, 1,1 Mio. Mitglieder
Energie: Energiegenossenschaften beteiligen die Menschen aktiv an der Energiewende. Ihr Ziel ist ein langfristiges Engagement der Menschen vor Ort und dadurch eine höhere Akzeptanz für erneuerbare Energien. Als regionale Energieversorger stellen sie bezahlbare und saubere Energie bereit. Über dieses Modell wurden bereits zahlreiche Erneuerbare-Energie-Projekte entwickelt und umgesetzt – sowohl beim Strom als auch bei der Wärme. Beteiligungen an Energiegenossenschaften beginnen in der Regel bei 50 Euro pro Anteil. Im Schnitt erwerben Mitglieder Anteile im Wert von 3.600 Euro.
Zahlen Dtl. 2024: 950 Unternehmen, 1.200 Beschäftigte, 2,1 Mrd. € Umsatz, 220.000 Mitglieder
Wohnungswesen: Wohnungsgenossenschaften versorgen ihre Mitglieder mit bezahlbarem Wohnraum und bieten ein sicheres Wohnverhältnis. Im Interesse ihrer Mitglieder investieren sie in den Wohnungsbestand und in Neubauten. Damit tragen sie zur Nachhaltigkeit von Städten und Gemeinden bei und stützen die Bauwirtschaft. Allein im Jahr 2023 wurden 2,3 Milliarden Euro in Neubauprojekte investiert. Zusätzlich schaffen sie ein lebenswertes Wohnumfeld, achten auf gute Nachbarschaft, die Raum für Begegnungen und ein solidarisches Miteinander schafft.
Zahlen Dtl. 2024: 1.800 Unternehmen, 24.300 Beschäftigte, 6 Mrd. € Investitionen, 2,9 Mio. Mitglieder
Gewerbe: Gewerbliche Genossenschaften sind das Rückgrat der mittelständischen Wirtschaft. Hier schließen sich vor allem Betriebe aus dem Handel und dem Handwerk zusammen, um beispielsweise beim Wareneinkauf Größenvorteile zu erreichen. Sie unterstützen ihre Mitgliedsbetriebe in betriebswirtschaftlichen Bereichen. Damit sichern sie die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit mittelständischer Unternehmen gegenüber großen Konkurrenten. Bekannte Beispiele im Einzelhandel sind Edeka, Rewe und Intersport. Außerdem gibt es Zusammenschlüsse für einzelne Branchen, wie die Bäko für Bäckereien und Konditoreien oder die Noweda für Apotheken.
Zahlen Dtl. 2024: 1.372 Unternehmen, 750.000 Beschäftigte, 193 Mrd. € Umsatz, 400.000 Mitglieder
Konsum: Konsumgenossenschaften legen großen Wert auf sozial verantwortliches Handeln und auf Verbraucherschutz. Sie achten beispielsweise auf kurze Lieferketten und Transparenz bei der Herkunft der Produkte. Damit fördern Sie den nachhaltigen Konsum ihrer Mitglieder. Gerade im ländlichen Raum schließen sie oft Versorgungslücken – ganz gleich ob als Supermarkt oder Kulturgenossenschaft.
Zahlen Dtl. 2024: 510 Unternehmen, 5.000 Beschäftigte, 1 Mrd. € Umsatz, 300.000 Mitglieder
Außerdem gibt es in Deutschland gut 200 Schülergenossenschaften. Sie bauen Möbel, betreiben Schulkioske, Imkereien, Cafés, bieten PC-Dienstleistungen an oder erstellen Schülerzeitungen. Sie ermöglichen den beteiligten Kindern und Jugendlichen Einblicke in ein solidarisch und demokratisch organisiertes Unternehmensmodell und vermitteln wirtschaftliche Grundlagen.

Gründung & Struktur
Der große Vorteil einer Genossenschaft liegt darin, dass sie nicht nur der Geschäftsführung oder dem Vorstand gehört, sondern allen: Jedes Mitglied ist durch seinen Anteil zugleich Eigentümer und hat damit auch gewisse Mitbestimmungsrechte. Ein weiterer Vorteil: Eine Genossenschaft lässt sich vergleichsweise einfach gründen: drei Personen genügen, einen Notar braucht es nicht. Die Rechtsform eignet sich dadurch gut für die Zusammenarbeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch von Selbstständigen.
Jedes Mitglied erwirbt Anteile an der Genossenschaft und wird somit gleichzeitig zum Inhaber und zum Kunden. Das Mitbestimmungsrecht ist basisdemokratisch geregelt: Jedes Mitglied hat eine Stimme – unabhängig von der Anzahl der erworbenen Anteile. Ab 1.500 Mitgliedern kann eine Vertreterversammlung an die Stelle der Generalversammlung treten, dort nehmen dann nur die gewählten Mitgliedsvertreter ihr Stimmrecht wahr. Wenn es Organe wie einen Vorstand oder Aufsichtsrat gibt, die ab einer bestimmten Mitgliederzahl erforderlich sind, dann werden diese aus den Genossenschaftsmitgliedern besetzt. Große Genossenschaften wie Wohnungsunternehmen oder Banken stellen Mitarbeiter ein, die nicht aus dem Mitgliedskreis stammen müssen und die sich um das operative Geschäft und die Verwaltung der Mitglieder kümmern.

Die Sozialwissenschaftlerin Gisela Notz schreibt in ihrem Buch „Genossenschaften. Geschichte, Aktualität und Renaissance“: „Viele Menschen in Deutschland stellen sich unter dem Begriff Genossenschaften lediglich Genossenschaftsbanken, bestenfalls Wohnungsbaugenossenschaften vor. Das zeigt sich auch in den vorliegenden Veröffentlichungen. Das ist schade, denn als Genossenschaft kann man Vieles gründen. Und Gründungen von Genossenschaften sind meist wirtschaftlich erfolgreicher als Einzelgründungen.“ Am Ende ihres Buchs fragt Notz nach dem utopischen Gehalt der „neuen Genossenschaften“, die mittlerweile verstärkt in den Bereichen Wohnen, Energie und Verbraucher-Erzeugergenossenschaften entstehen, z.B. in Form von Solawis, bei denen Obst und Gemüse gemeinsam angebaut und geerntet wird. Auch in Schüler- und Kulturgenossenschaften sind so in den vergangenen Jahren neue Gestaltungsräume entstanden. Für kleine private Wohnprojekte eignet sich die Rechtsform ebenfalls. Viele der 125 Genossenschaftsgründungen im vergangenen Jahr waren solche kleinen Projekte. Vor allem Genossenschaften zur regionalen Entwicklung waren dabei. So wurden beispielsweise Dorfgasthäuser oder andere soziale Treffpunkte von Genossenschaften renoviert und übernommen.
Genossenschaften im ländlichen Raum
Schon eine 2021 veröffentlichte Studie zu Bürgergenossenschaften in den neuen Ländern bestätigte den Trend hin zu genossenschaftlichen Projekten auch im Kleinen. Und genau dieser Trend könnte dem Miteinander guttun, Genossenschaften werden sozusagen zum Demokratie-Booster: Denn sie schaffen, so die Studienautoren, „soziale Orte und Räume, in denen Werte vermittelt, verhandelt und praktiziert werden. Damit erreichen und verbinden sie in Zeiten zunehmender Polarisierung auch Bevölkerungsgruppen, die sonst kaum zueinander finden würden.“ In Genossenschaften lassen sich leichter Kompromisse aushandeln und Interessenskonflikte beilegen, Wandel kann auf lokaler Ebene gestaltet werden. Als ein positives Beispiel wird die Energiewende hervorgehoben. Denn Genossenschaften sind das ideale Modell, um die Menschen vor Ort an der Energiewende zu beteiligen – finanziell und inhaltlich. Denn wenn ihnen Windparks und Solarflächen gehören, dann können sie mitentscheiden, wo diese entstehen, die Gewinne fließen nicht in große Konzerne, sondern bleiben vor Ort. Ein weiteres Ziel, das in der Praxis meist an bürokratischen Hürden scheitert, ist der Bezug eben jener erneuerbaren Energie. Allein im Raum Boxberg-Weißwasser sind in den vergangenen Jahren vier Energiegenossenschaften gegründet worden, weitere sind in Vorbereitung.
Gerade in ländlichen Räumen wie der Lausitz können Genossenschaften auch als Modell dienen, um bestehende oder drohende Versorgungslücken zu schließen. Dort wo sich der Staat zurückgezogen hat, Ehrenamtliche sich nicht mehr engagieren und privatwirtschaftliche Angebote sich nicht mehr rechnen, können Menschen vor Ort über Genossenschaften das entstandene Vakuum füllen. Der Abschlussbericht der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse des Bundesinnenministeriums von 2019 empfiehlt die genossenschaftliche Idee sogar explizit zur Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen: „Für die verschiedenen Aufgabenfelder der Sicherung der ländlichen Daseinsvorsorge können Genossenschaften mit ihrer demokratischen Organisationsform und ihrer örtlichen bzw. regionalen Einbindung eine Lösung sein: Die Menschen vor Ort nehmen ihr Geschick selbst in die Hand und finden passgenaue Lösungen. Genossenschaften gehören somit zu den Erfolgsmodellen für starke ländliche Räume. Sie fördern die regionale Wertschöpfung, binden bürgerschaftliches Engagement ein und erfüllen anstehende Aufgaben nachhaltig. […] Wir empfehlen die Förderung des Aufbaus und der Stärkung genossenschaftlicher Modelle zur Sicherung der Daseinsvorsorge in den ländlichen Räumen (z. B. genossenschaftliche Dorfläden, genossenschaftliche Modelle zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung, genossenschaftlich organisierte Bürgerbusse und Carsharing-Angebote).“
Auf diese Weise besteht die Chance, in Dörfern und kleinen Gemeinden Angebote wie Kneipen, Dorfläden, Kulturbühnen, Programmkinos oder Sportstätten zu bewahren. Die Genossenschaftsidee passt auch deswegen gut zum ländlichen Raum, weil ehrenamtliches Engagement hier eine lange Tradition hat und meist stärker verbreitet ist als in anonymen Großstädten. Diese Tradition trifft seit etwa der Jahrtausendwende auf eine Renaissance der Genossenschaftsidee. Ein Grund dafür könnten die vielen Krisen sein, die den Kapitalismus mit seiner starken Profitorientierung zumindest in Frage stellen. Genossenschaften gelten als resilient und krisensicher. Mirko Lippmann von der VR Bank Lausitz blickt im Interview mit der lausebande auf die Finanzmarktkrise zurück: „Gerade solche Krisen bringen uns als Regionalbank verstärkten Zuspruch. Wir konnten viele Kunden und Mitglieder gewinnen, die explizit diese Nähe gesucht haben, die wir bieten können, eben weil wir vor Ort sind.“
Die traditionsreiche Genossenschaftsidee hat also nichts an ihrer Aktualität verloren. Als sie 2016 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde, wurden in der offiziellen Begründung unter anderem der demokratische Gedanke und das zivilgesellschaftliche Potenzial hervorgehoben: Durch ihre demokratisch aufgebaute Organisationsstruktur, ihre starke Mitgliederorientierung und ihr zivilgesellschaftliches Engagement übernähmen sie gesellschaftliche Verantwortung: „Die Idee der Kooperation, der Gedanke des Kräftebündelns und der synergetische Austausch unter Einbeziehung der Selbstständigkeit bieten weitreichende Möglichkeiten, um neben bestimmten ökonomischen Auswirkungen auch ökologische, soziale oder kulturelle Wandlungsprozesse aufzufangen und mitzugestalten.“ Ein solcher Wandel passiert gerade im Lausitzer Revier. Wer diesen nicht als Genossenschaftsmitglied mitgestalten will, der hat zumindest im Alltag viele Möglichkeiten, die Genossenschaftsidee zu fördern – indem man bewusst die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen nutzt.
„Ich finde, dass die Genossenschaftsidee eine große Tradition hat, aber sie hat auch eine große Zukunft, und das ist für mich das entscheidende.“
Prof. Dr. Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission
Weiterführende Informationen
Gisela Notz: Genossenschaften. Geschichte, Aktualität und Renaissance (2023), ISBN: 978-3-89657-030-7: Auf gut 270 Seiten beleuchtet die Autorin in diesem Buch die Geschichte der Genossenschaften aus der sozialistischen und der bürgerlichen Begründungsperspektive. Historisch werden Aufstieg und Fall der Genossenschaften während verschiedener Epochen nachgezeichnet. Abschließend fragt die Autorin nach dem utopischen Gehalt der «neuen Genossenschaften», die vor allem im Wohnungsbau, als Energiegenossenschaften und Verbraucher-Erzeugergenossenschaften entstehen.
www.dgrv.de: Die Online-Präsenz des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands hält zahlreiche Informationen, Daten & Fakten sowie aktuelle Meldungen zu Genossenschaften in Deutschland bereit.
www.genossenschaften.de: Die Internetseite des Dachverbands DGRV gibt Tipps und Hinweise für diejenigen, die über die Gründung einer Genossenschaft nachdenken.
Studie: Aufbruch in die WIR-Ökonomie. Perspektiven, Potenziale und Pioniere. Zur Zukunft von Genossenschaften. Für die Studie hat das Zukunftsinstitut in Zusammenarbeit mit dem „Genossenschaftsverband – Verband der Regionen“ Genossenschaften interviewt, die als Pioniere den Wandel aktiv gestalten und bereits neue Geschäftsfelder entwickeln. Die Studie kann hier abgerufen werden.

Praxis: 6 Genossenschaftsmodelle aus der Region

Terp‘sche Bürgergenossenschaft
Die Dorfgemeinschaft weiterentwickeln und ihr eine wirtschaftliche, sozial-kulturelle, und ökologische Perspektive geben – mit diesem Ziel ist die Terp’sche Bürgergenossenschaft 2019 gestartet. „Für uns war die Genossenschaft damals das beste Modell, einen Kredit wollte uns die Bank nicht geben“, erzählt Vorstand Joachim Klammer. Also hat man auf das Genossenschaftsmodell gesetzt und zusätzlich Genussrechte ausgegeben. Aktuell gehören der Terp’schen Bürgergenossenschaft 22 Mitglieder an – vom Familienvater bis zum Ruheständler. Jeder von ihnen hat mindestens einen Anteil in Höhe von 200 Euro erworben. Mit dem Kapital kann die Dorfgemeinschaft zehn Hektar Fläche bewirtschaften, die werden für den Anbau von Getreide und Heu genutzt und für zwei Hühnermobile. Etwa 400 Hühner legen täglich Eier. Die sind biozertifiziert und werden über den Direktverkauf im Dorf und in zwei Einkaufsmärkte in Cottbus verkauft. Die Nachfrage ist groß. Das zweite Standbein der Genossenschaftler sind Dienstleistungen in Forstwirtschaft und Gartenbau. Zwei Angestellte hat die Genossenschaft und sie würde noch weiter wachsen, wenn sie entsprechende landwirtschaftliche Flächen findet. Der Bedarf ist da. Das Ziel, die Dorfgemeinschaft zu stärken und eine neue Perspektive zu schaffen, ist bereits erreicht.

© Andreas Franke
Energiegenossenschaften
Wer sich mit Bürgerenergiegenossenschaften in der Oberlausitz beschäftigt, kommt an Helmut Perk nicht vorbei. In den vier Genossenschaften in Kodersdorf, Boxberg, Rietschen und Weißkeißel sitzt er im Vorstand. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt ihn das Thema Energiewende: „Mir ist es wichtig, dass die Menschen vor Ort beteiligt werden, dass sie auch etwas davon haben, wenn bei ihnen in der Nachbarschaaft Windkraft- oder Solaranlagen entstehen.“ Und so hat er in den vergangenen Jahren immer wieder Projekte und Initiativen angestoßen und begleitet, bei denen die Bürger oder auch kommunale Einrichtungen wie Schulen von den erneuerbaren Energien profitieren, sei es über Gewinnbeteiligung oder über die Nutzung der grünen Energie, wobei letzteres für Privatpersonen aus rechtlichen Gründen derzeit noch schwierig ist. Dafür wird die jüngste Genossenschaftsgründung in Weißkeißel sich am Bau eines Hybrid-Energieparks aus Wind und Sonne beteiligen. Insgesamt plant ein privater Investor 17 Millionen Euro zu investieren. Von der Investition und der späteren Einspeisevergütung sollen auch die Menschen vor Ort profitieren. Um möglichst Viele zu beteiligen, wollen sich die Bürgerenergiegenossenschaften in Weißkeißel, Kodersdorf, Boxberg und Rietschen in einem Genossenschaftsverbund zusammenschließen, der dann etwa 400 Mitglieder zählt. Helmut Perk und seine Mitstreiter sind auf einem guten Weg, die Energiewende mitzugestalten und durch mehr Beteiligung für mehr Akzeptanz zu sorgen.

© WoGe Finsterwalde
WoGe Finsterwalde
Die Wohnungsgenossenschaft Finsterwalde eG verbindet wie eine große, genossenschaftliche Familie die Themen Wohnen und Leben. Durch den Zusammenschluss von sieben lokalen Genossenschaften entstanden, deren älteste 1927 gegründet wurde, bietet die WoGe heute ein breites Wohnungsangebot inklusive Dienstleistungen rund ums Wohnen. Mit seinen Wohnungen in Finsterwalde und den umliegenden Gemeinden steht das genossenschaftliche Unternehmen für bezahlbares und komfortables Wohnen. Die etwa 2.500 Mitglieder sind gewissermaßen „Mieter im eigenen Haus“. Das verschafft ihnen nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch ein lebenslanges Wohnrecht. Zudem besitzen sie ein Mitspracherecht, denn die Interessen aller Mitglieder werden durch gewählte Vertreter wahrgenommen. Die aktuell 50 Vertreter fungieren für die Bewohner ihres Wahlbezirks als direkter Draht zum Vorstand, sie lassen sich Sachverhalte erklären, kritisieren, loben, liefern Ideen, geben Wünsche und Fragen der Nachbarn weiter. Schlussendlich stimmen sie auf den Vertreterversammlungen über alle wichtigen Belange zur Entwicklung der Genossenschaft ab. Die WoGe hat in den vergangenen Jahren mehrere Sanierungsvorhaben und zwei Neubau-Projekte umgesetzt und so die Wohnqualität erhöht. Darüber hinaus engagiert sie sich in Projekten vor Ort – vom Tierpark über das Sängerfest bis zur Feuerwehr.

© Foto: Johannes Zantow
VR Bank Lausitz eG
Den deutschen Begründer der Genossenschaftsidee Friedrich Wilhelm Raiffeisen trägt die VR Bank Lausitz bis heute im Namen: Das Kürzel VR steht für die Volks- und Raiffeisenbanken, deren Wurzeln bis zu den ersten Kreditgenossenschaften Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen und die heute 17,6 Millionen Mitglieder zählen. Fast 12.000 davon vertrauen der VR Bank Lausitz eG, der größten in Südbrandenburg. Das Filialnetz mit 16 Geschäftsstellen erstreckt sich über fünf Landkreise und Cottbus. Wie die anderen Genossenschaftsbanken ist auch die VR Bank Lausitz zuerst ihren Mitgliedern und Kunden verpflichtet. Die Mitglieder entscheiden auf der Vertreter-Versammlung zum Beispiel über die Genehmigung des Jahresabschluss‘, über die Verwendung des Gewinns und die Besetzung der Kontrollgremien. Dabei gilt: ein Mitglied, eine Stimme – unabhängig davon, wie viele Geschäftsanteile man besitzt. Die genossenschaftlichen Werte spiegeln sich auch im Kunden-Geschäft wider: Beraten wird entsprechend der genossenschaftlichen Werte solidarisch, fair, partnerschaftlich und persönlich. Das Genossenschaftsprinzip „Viele schaffen mehr“ gilt ebenso für die gleichnamige Crowdfunding-Plattform der Volksbank: Über die Plattform können gemeinnützige Vereine Spenden für bestimmte Vorhaben sammeln. Jedes Projekt, das es in die Finanzierungsphase schafft, wird zusätzlich durch die Bank gefördert. Im vergangenen Jahr hat die VR Bank Lausitz gemeinnützige Vereine und Initiativen in der Region mit knapp 50.000 Euro unterstützt.

© Wilde Möhre GmbH
Festival Wilde Möhre
Seit gut zehn Jahren wird eine grünes Fleckchen Erde zwischen Drebkau und Calau immer im Sommer zur Oase für Musik, Kunst, Entspannung und Nachhaltigkeit. Ende August laden die Organisatoren zum „Wilde Möhre“-Festival. In diesem Jahr steht hinter ihnen erstmals eine Genossenschaft: Die „mit Freude eG“ fungiert als Holding über dem Festival, das selbst eine GmbH geblieben ist. Mit der Genossenschaft wollen die Macher die Festival-Fans noch enger an die Idee und Mission der Wilden Möhre binden. Ab 100 Euro Anteil ist man dabei und kann in der Generalversammlung über die Gestaltung des Festivals mitbestimmen. Mehr als 700 Anteile wurden bereits vergeben. Es geht den Initiatoren aber auch darum, über das Genossenschaftsmodell Kulturräume vor Privatinvestoren zu schützen und langfristig zu erhalten – indem die Kulturschaffenden selbst Eigentum erwerben. Die Mitglieder sichern so nicht nur langfristig Veranstaltungen wie die Wilde Möhre, sie profitieren auch von Vorteilen wie vergünstigten Festivaltickets und exklusiven Genossenschaftsveranstaltungen. Für den Aufsichtsrat und den Beirat konnten namhafte Fachleute – auch aus der Lausitz – gewonnen werden. Die Wilde Möhre als eine Art Vorzeigeprojekt und soll nicht das einzige bleiben. Die Idee ist, dass die Freude eG alsbald weitere Projekte und Orte unter sich bündelt.

© CC BY-SA, PaulT/Wikipedia
Wohnprojekt im Haselbachtal
Was 2010 als Idee von einer Gruppe Dresdner begann, ist heute ein Wohnprojekt im Haselbachtal unweit von Kamenz. Etwa drei Dutzend Menschen besitzen und bewohnen zwei Höfe im Dorf. Dabei steht der Genossenschaftsgedanke im Vordergrund: Die Mitglieder der Genossenschaft „Leben im Grünen eG“ haben sich zusammengeschlossen, um die beiden Häuser, die sie bewohnen, selbst zu verwalten. Grundstücke, Räume, Werkzeuge und Ideen werden miteinander geteilt. Außerdem gibt es gemeinsame Feste und andere Aktivitäten. Wer sich für eine Mitgliedschaft entscheidet und Anteile erwirbt, kann günstigen, sicheren und zugleich ökologisch verantwortbarem Wohnraum nutzen. Da die dort Wohnenden Mieter und Eigentümer zugleich sind, liegt auch die Verwaltung der Höfe in ihrer Hand. Einmal monatlich trifft sich die Wohngemeinschaft zum „Bausamstag“, um Arbeiten an den Häusern und im Außengelände zu erledigen. Zum Grundstück gehören eine kleine Streuobstwiese sowie Anbauflächen für Obst und Gemüse, die ebenfalls selbst bewirtschaftet werden. Auch ein paar Hühner und Schafe gehören zur Gemeinschaft. Aktuell sucht die Genossenschaft neue Mitglieder: Interessierte, die ebenfalls nachhaltig und selbstverwaltet im Grünen leben wollen, können sich für eine Wohnung bewerben, die ab Herbst frei wird.